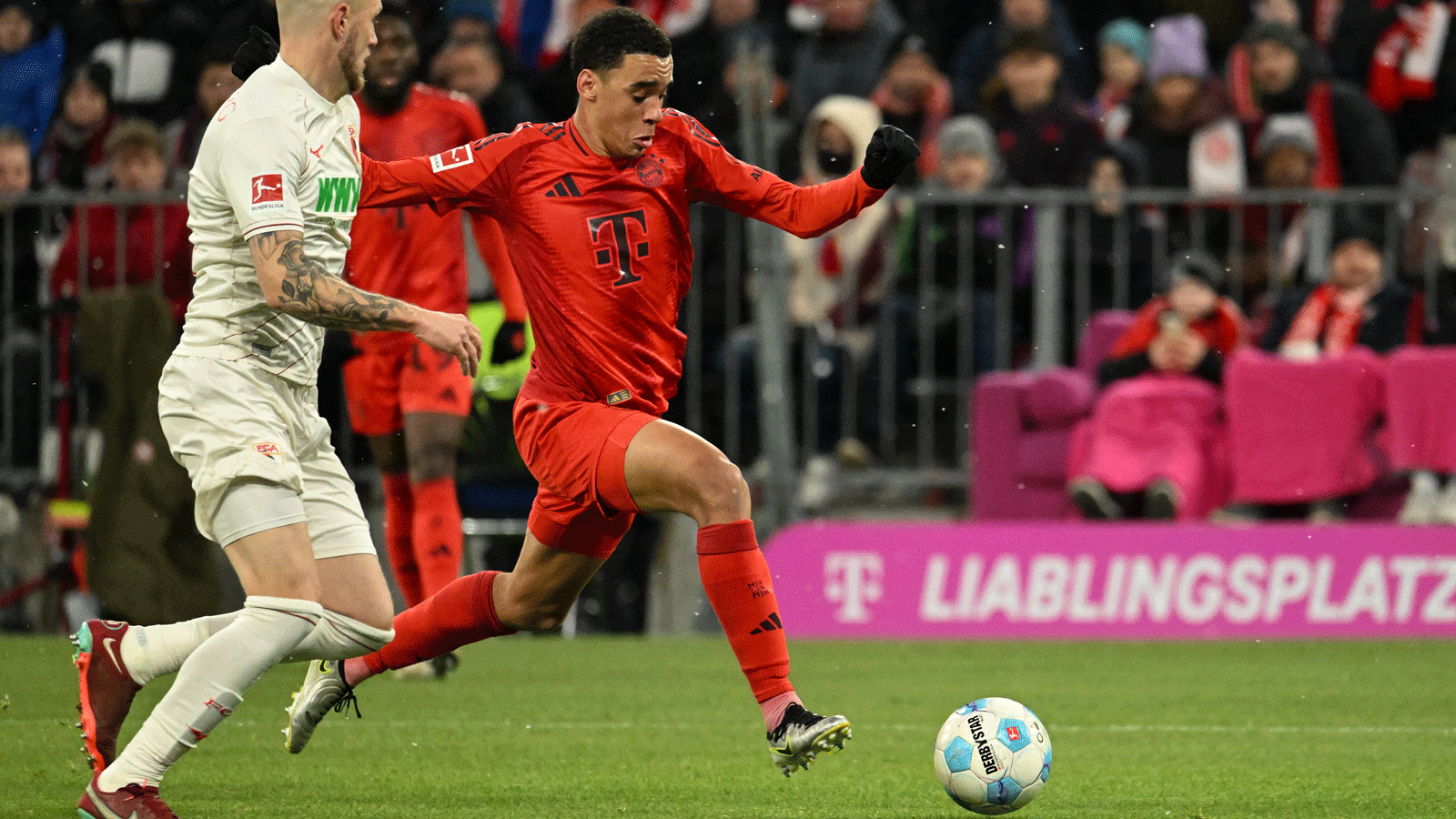Von Jörg Allmeroth aus New York City
Als Angelique Kerber Ende Oktober 2016 in Singapur das Weltmeisterschaftsfinale gegen die Slowakin Dominika Cibulkova verlor, hätte sie sich drei, vier Wochen in die Ferien verabschieden können. Das beste Jahr einer deutschen Tennisspielerin nach den goldenen Zeiten von Steffi Graf lag hinter der tüchtigen Kielerin, es wäre der richtige Zeitpunkt für Sonne, Strand und süßes Nichtstun gewesen. Doch Kerber gönnte sich rastlos nicht mal zwei Wochen Urlaub, sie hatte schon wieder die Sorge, die Vorbereitung könne zu kurz kommen. Und dann war da auch noch der dringende Wunsch, es 2017 noch einmal all jenen beweisen zu wollen, die von glücklichen Zufällen bei der Siegesserie redeten - immer noch glaubte Kerber, auf manche Kritiker und Zweifler reagieren zu müssen. Und vergaß dabei ganz, dass sie, die damalige Nummer 1, längst widerlegt hatte, nur ein One-Hit-Wonder zu sein.
In jenen Herbsttagen des letzten Jahres war die Krise angelegt, die Kerber hartnäckig über frustrierende Wochen und Monate dieser Spielzeit begleitete. Nie wieder erreichte die 29-jährige Kielerin jene schwindelnden Höhen und rauschhaften Momente des goldigen Jahres 2016, von den ersten Metern an war sie gefühlt in der Defensive, rannte dem enteilenden Feld der Konkurrentinnen und der eigenen Form hinterher, wirkte zerschlissen im PR-Dauertrubel um ihre Nummer-1-Position. "Zu knapp sei die Phase des Ausspannens" gewesen, gab Kerber nun auch selbst zu, "aber nachher ist man immer schlauer." Jedenfalls fehlte es an allem bei Kerber, in New York und überhaupt in dieser Saison: An der körperlichen und geistigen Frische, an Selbstbewusstsein, an jener Qualität auch, in den entscheidenden Matches mit der Größe der Herausforderung wachsen zu können.
Lebloser Grand-Slam-Tiefpunkt
Und auch die letzte Chance, dieser verkorksten, verdrucksten, verfluchten Serie im Wanderzirkus bei den US Open noch einen verblüffenden Dreh zu geben, verpaßte sie dann mit aller nur denkbaren Wucht. Was Kerber beim 3:6, 1:6-Auftaktdesaster gegen die 19-jährige Zukunftshoffnung Naomi Osaka in Runde eins im Arthur Ashe-Stadion bot, war über 64 bittere Minuten das passgenaue Spiegelbild eines ganzen Jahres, ein grauer, lebloser Grand-Slam-Tiefpunkt an einem trostlos-verregneten Dienstag. Zurückgestoßen wirkte die Tenniskönigin des Vorjahres wieder in jene Zeiten ihrer Karriere, in denen sie selbst oft die größten Zweifel an sich herumschleppte. Und in wichtigen Momenten eher das Mögliche unmöglich machte.
Ohne die felsenfeste Sicherheit, mit starker Physis und Fitness im Wanderzirkus umhertouren zu können, ist Kerber nicht konkurrenzfähig im Machtspiel an der absoluten Tennisspitze. "Die Wahrheit ist ganz banal: Wenn sie immer einen halben Schritt zu spät zu den Bällen kommt, kann sie ihre Stärken nicht mehr ausspielen", sagte am Dienstagabend die US-Legende Chris Evert. "Im letzten Jahr war sie die Drahtigste, die Schnellste, die Eiserne Lady. Sie wirkte immer wie ein Fels in der Brandung." Auch bei den US Open war das so, vor zwölf Monaten, beim größten Abenteuer ihrer Karriere, beim Sturm auf Platz 1, beim Finalsieg: Kerber flitzte umher wie ein Wirbelwind, es war schlicht atemraubend, welche Bälle sie erreichte und wie sie aus der Bedrängnis noch Gewinnschläge produzierte. Doch an diesem 29. August 2017 nun war das Spiel, der Auftritt, die ganze Kerber nur eine matte Kopie der Championspielerin, eine früh resignierende Wettkämpferin, die nicht bedingungslos an sich glaubte, auch wenn sie genau das später mit dünner Stimme versicherte: Sie habe nie aufgegeben und "bis zum letzten Punkt alles versucht". Sie sagte dann auch, sie "werde stärker zurückkommen und das alles nicht so stehen lassen." Aber Gewissheiten gibt es dafür nicht.
Kampf auf Biegen und Brechen
Es gab nur einen Augenblick in diesem Jahr, in dem sich deutlich die Spurenelemente der Erfolgsspielerin des Vorjahres zeigten - das war in Wimbledon, im Achtelfinale gegen die spätere Siegerin Garbine Muguruza. Es war das beste Spiel der Saison im Frauentennis, ein Kampf auf Biegen und Brechen, den Kerber unglücklich verlor. Doch die Hoffnung, dass jenes Match eine Initialzündung für den Rest des Jahres sein könnte, zerschlug sich spätestens in New York. "Es war komplett nicht mein Tag", sagte Kerber später, fügte dann fatalistisch hinzu: "So ist das Leben. Mal schafft man alles, mal läuft gar nichts." Sie habe schon oft bewiesen, "aus diesen schweren Situationen wieder heraus zu kommen", so Kerber. "Ich gebe jetzt ganz sicher nicht auf."
Allerdings wirkte diese Niederlage schon wie ein Knockout-Schlag, der nicht so einfach weggesteckt werden kann. Denn New York, die US Open, das ist eigentlich Kerbers Pflaster, es ist das Turnier, mit dem sie die angenehmsten Erinnerungen verbindet: 2011 rückte sie als stolze Halbfinalistin erstmals international ins Rampenlicht, 2016 beschloss sie hier ihren langen Aufstiegsmarsch zum Tennisgipfel triumphal. Und nun die krachende Niederlage als Titelverteidigerin, die Niederlage auch für das neu aufgestellte Trainerteam mit Benjamin Ebrahimzadeh als Impulsgeber neben Torben Beltz. Sie alle lieferten nun ein ganz anderes, unschönes Schlussbild in New York, als desillusionierte Verlierer, in regelrechter Fluchtbewegung vom Centre Court sah man schließlich das Team Kerber. "So einen Tag will man ganz schnell aus dem Gedächtnis streichen", sagte Kerber. Den Tag. Und das ganze Jahr.