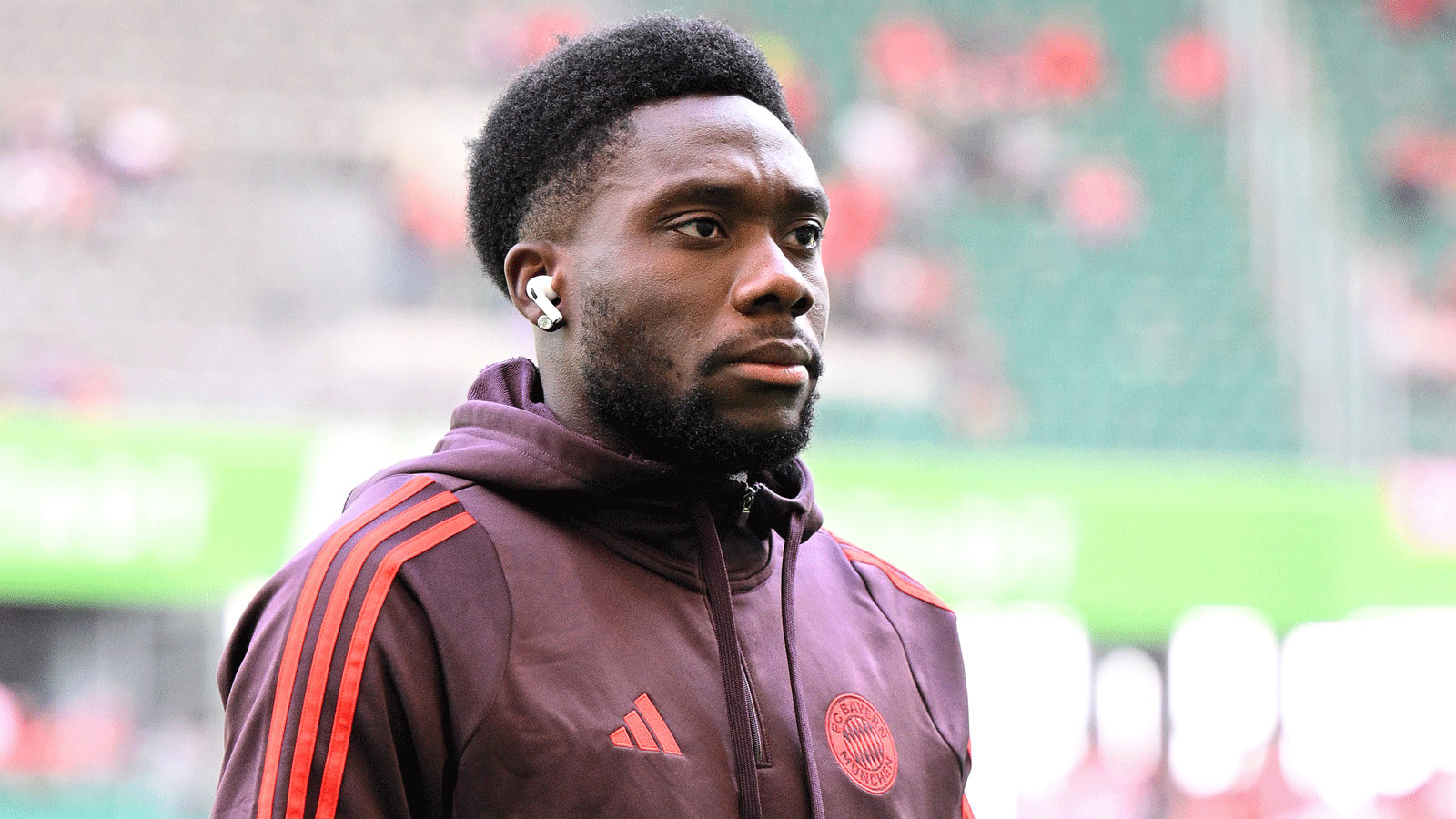Bis 2016 blieben Sie in Leipzig. Wie blicken Sie heute auf den Athletik-Bereich im Fußball?
Lobinger: Es ist ein Bereich, der meiner Meinung nach immer noch in den Kinderschuhen steckt. Viele Vereine stehen immer noch ganz am Anfang. Ich glaube, dass wir sogar Schritte zurückgemacht haben. Man darf den Namen Jürgen Klinsmann ja kaum mehr in den Mund nehmen, aber man kann ihm vorwerfen, was man will, in diesem Bereich war er ein Vorreiter und hat gezeigt, wie der Fußball vom Know-how anderer Sportarten profitieren kann. Er hat damals die Position des Athletik-Trainers mehr gestärkt, als es inzwischen der Fall ist.
Woran liegt das?
Lobinger: Leider ist es so, dass oft Sportdirektoren und Trainer die meisten Entscheidungen treffen und dort in verschiedenen Fachbereichen manchmal die Expertise fehlt. Ich glaube, dass wir in Deutschland im Scouting-Bereich deutlich besser aufgestellt sind als im Athletik-Bereich. Da müssten in den Vereinen viel mutigere Diskussionen geführt werden. Wenn dort mehr Wert gelegt würde, würden wir auch noch schnellere, robustere und fittere Spieler bekommen, die auch seltener verletzt wären. Aktuell haben wir das Phänomen, dass manche U17-Mannschaften besser trainieren als manche Profi-Mannschaften. Ich hoffe, dass sich der Fußball dort wieder in die richtige Richtung entwickelt und sich die nötige Expertise ins Haus holt. Und dass dann auch die Dinge umgesetzt werden und nicht nur so getan wird, als ob man es macht.
Sie haben in Leipzig schon den ganz jungen Joshua Kimmich kennengelernt, mit dem Sie bis heute eng zusammenarbeiten. Was haben Sie in ihm gesehen?
Lobinger: Es bedarf nur einer gemeinsamen Autofahrt oder eines gemeinsamen Kaffees, um zu verstehen, was für ein Feuer in Jo brennt. Ich habe Spieler erlebt, die neben dir in der Trainingshalle stehen und du denkst, dass sie verstanden haben, worum es geht. Aber sobald sie die Trainingshalle verlassen, haben sie alles vergessen, was sie gerade noch gepredigt haben. Diese Spieler werden nie den Erfolg haben, den sie haben könnten. Vielleicht fällt es ihnen mit 35 ein, aber dann ist es zu spät. Es gibt viele, die sich auf ihrem Talent ausruhen. Jo ist das komplette Gegenteil. Stillstand ist das Schlimmste für ihn. Jo trainiert in jeder Einheit wie andere nur in kompletten Krisenzeiten. Er dreht wirklich jeden Stein um, weil er immer wissen will, wo er sich noch verbessern kann. Er hinterfragt auch sein Umfeld, privat wie beruflich, die ganze Zeit und überlegt, wie er noch ein bisschen was rauskitzeln und optimieren kann.
Tim Lobinger über Joshua Kimmich: "Er scheißt sich halt nichts, sondern zieht es durch"
So wie Sie früher?
Lobinger: Ja, wir sind uns da wohl ähnlich und haben uns auch deshalb so gut gefunden. Ich hätte mich als Sportler nie gerne trainiert, weil ich alles hinterfragt habe. So ist Jo auch. Es ist extrem schwer, ihn zufriedenzustellen, aber wenn man sich darauf einlässt, dann marschiert er. Mit Jo kannst du in die Schlacht ziehen und sie gewinnen. Er ist kein Verstecker. Er ist ein Sich-Zeiger. Wenn er etwas sagt, dann ist es etwas Gehaltvolles. Er hat jede Menge auf der Festplatte, kann das abrufen und ist bereit, immer neue Dinge aufzunehmen. Andere sind nach einer guten Saison bei Bayern satt, für ihn ist das nur eine nächste Etappe. Selbst wenn er in ein paar Jahren zweimal die Champions League gewonnen hat, wird er sich danach darüber Gedanken machen, wie er im nächsten Finale noch besser spielen kann, oder wie er dazu beitragen kann, dass die Mannschaft beim nächsten Mal auf dem Weg ins Finale weniger Kraft vergeudet. So tickt er. Er denkt immer den einen Schritt weiter. Das ist beeindruckend.

Er war auch an Ihrer Seite, als Sie mit Ihrer Leukämie-Erkrankung im Krankenhaus lagen.
Lobinger: Jo hätte allen Grund gehabt, nicht ins Krankenhaus zu kommen, aber es zeigt, wie er mit der Öffentlichkeit umgeht. Er scheißt sich halt nichts, sondern zieht es durch. Er sperrt sich nicht zu Hause ein und schließt sich nicht vor der Welt weg. Wenn er Lust hat, in der Stadt einen Kaffee trinken zu gehen, dann geht er in der Stadt einen Kaffee trinken. Dann schauen die Leute vielleicht, aber er hat seinen Kaffee getrunken. Er hat diese Selbstverständlichkeit, die vielen in seiner Position fehlt. Als er bei mir im Krankenhaus war, hat er das Gefühl gehabt, ich helfe ihm mehr als er mir. Aber er hat mir natürlich sehr geholfen. Wir haben über ganz normale Dinge gesprochen. Ich habe meine Erkrankung ihm gegenüber wie eine kleine Grippe verkauft. Ich musste auch nicht großartig thematisieren, wie schlecht es mir geht, das konnte ja jeder sehen. Erst als wir das erste Mal wieder in einem Restaurant essen gehen konnten, habe ich ihm klargemacht, wie sehr bei mir alles auf Messers Schneide stand. Vorher habe ich so getan, als ob ich jetzt sinnbildlich 0:2 hinten liege, ohne dass ich etwas für die Gegentore kann, und jetzt den Rückstand wieder wettmachen muss.
Tim Lobinger: "Habe ich irgendwas genommen, was im Zusammenhang mit der Erkrankung stehen könnte?"
Der Tag der Blutkrebs-Diagnose war im März 2017, es war auch noch der Geburtstag Ihres Vaters. Wie blicken Sie heute auf diesen Tag zurück?
Lobinger: Als der Arzt reinkam und mir sagte, dass er sich jetzt erst mal selbst setzen müsse, wusste ich: Er begegnet mir auf Augenhöhe, jetzt haut es rein. Als dann das Wort Leukämie fiel, hat es mich umgehauen. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich dachte schon, dass es etwas Schlimmes sein würde, aber ich hatte in die Richtung Magengeschwür oder von mir aus Darmkrebs gedacht. Etwas, was sich durch den ganzen Stress in meinem Leben erklären lassen würde. Oder durch das, was mein Körper alles mitmachen musste in meiner Karriere, auch durch mein brutales Training. Natürlich auch durch viele Schmerzmittel. Ich bin ja bis ins greisenhafte Alter gesprungen. Das hätte ich alles verstanden, aber Leukämie hatte ich nicht auf dem Schirm. Nach der Diagnose war es bei mir zuerst, wie man es klassisch aus der Psychologie kennt. Spätestens 90 Sekunden danach ist man nicht mehr in der Lage, dem Menschen gegenüber zuzuhören.
Welche Gedanken haben Sie als Erstes gehabt?
Lobinger: Die ersten Gedanken lagen irgendwo zwischen Testament schreiben und einer To-Do-Liste erstellen, was jetzt alles zu erledigen ist. Am wichtigsten war mir, ob ich meine Krankheit an meine Kinder vererben kann. Als ich verstanden habe, dass das nicht der Fall ist, war ich zu 99 Prozent erst mal erleichtert. Das war für mein inneres Gleichgewicht ganz entscheidend. Der zweite wichtige Punkt war die Frage, ob ich mir irgendetwas vorzuwerfen habe. Habe ich irgendwas genommen, was im Zusammenhang mit der Erkrankung stehen könnte? In dieser Situation ist man bereit, die Hosen komplett runter zu lassen.
Was war Ihre Antwort?
Lobinger: Ich habe niemals gedopt und nie etwas ausprobiert. Ich habe einmal den sauren Regen von Tschernobyl abbekommen. Das ist das Einzige, bei dem es einen medizinischen Zusammenhang zur Leukämie geben könnte. Ich habe relativ schnell versucht, mich auf die Situation einzustellen und zu sagen: 'Okay, ich stehe mit dem Rücken zur Wand, jetzt muss ich funktionieren und kämpfen'. Ich habe mich in die Hände der Ärzte begeben und brav alles durchgezogen, was auf mich zukam. Vor allem die drei Chemotherapie-Zyklen waren schon sehr heftig. Da laufen Bestrahlungen eher gemütlich ab.

Tim Lobinger: "Ich war in dieser Zeit Beifahrer in meinem eigenen Leben"
Wie hoch waren Ihre Überlebenschancen? Es war von 30 Prozent die Rede.
Lobinger: Es gab auch Ärzte, die von einem Drittel von einem Drittel sprachen. 30 Prozent waren sehr positiv ausgedrückt, sagen wir es so.
Hatten Sie in den schlimmsten Stunden den Gedanken, dass es vielleicht besser ist, wenn es vorbei wäre?
Lobinger: Diesen Gedanken hatte ich zum Glück nie, ich wollte nie loslassen. Auch nicht in der schwierigsten Zeit auf der Isolationsstation. Diese Zeit war brutal. Du kannst den Raum nicht verlassen, du kannst kein Fenster öffnen, du hörst die ganze Zeit die Lüftung - es ist wirklich furchtbar. Ich durfte mich einmal am Tag für 30 Minuten im Zimmer frei bewegen, ohne direkt an die Geräte angeschlossen zu sein. Es ist eine Extremsituation, die viele Menschen, die dort liegen, wahrscheinlich für immer verändert. Hätte ich nicht die Unterstützung meiner Frau gehabt, die mich immer besucht hat, weiß ich nicht, wie ich das überstanden hätte. Du bist in einem Zustand, in dem du überhaupt keine Kraft mehr hast, und gleichzeitig erlebst du die totale Vereinsamung. Meine Familie hat mich da wirklich gerettet.
Haben Sie viel geweint in der Zeit der Behandlung?
Lobinger: Wenn ich alleine war, habe ich meist nur geweint, wenn es durch eine Szene in einem Film oder in einer Serie ausgelöst wurde. An Game of Thrones kann ich mich noch erinnern, da habe ich manchmal übertrieben geweint und da ist dann alles aus mir herausgebrochen. Ansonsten haben meine Frau und ich geweint, wenn wir uns etwas fest vorgenommen hatten und das nicht geklappt hat. Einmal wollten wir zu einer Hochzeit eines befreundeten Pärchens nach Salzburg fahren, aber mir ging es so schlecht, dass dazu keine Chance bestand. Ich hätte schon im Krankenwagen hingefahren werden müssen. Das ging alles nicht. Ich musste auch lange Zeit jeden Tag Transfusionen bekommen, bin in die Praxis mit schlechten Werten rein und mit besseren Werten wieder raus. Ich war in dieser Zeit Beifahrer in meinem eigenen Leben, so hat es sich angefühlt.