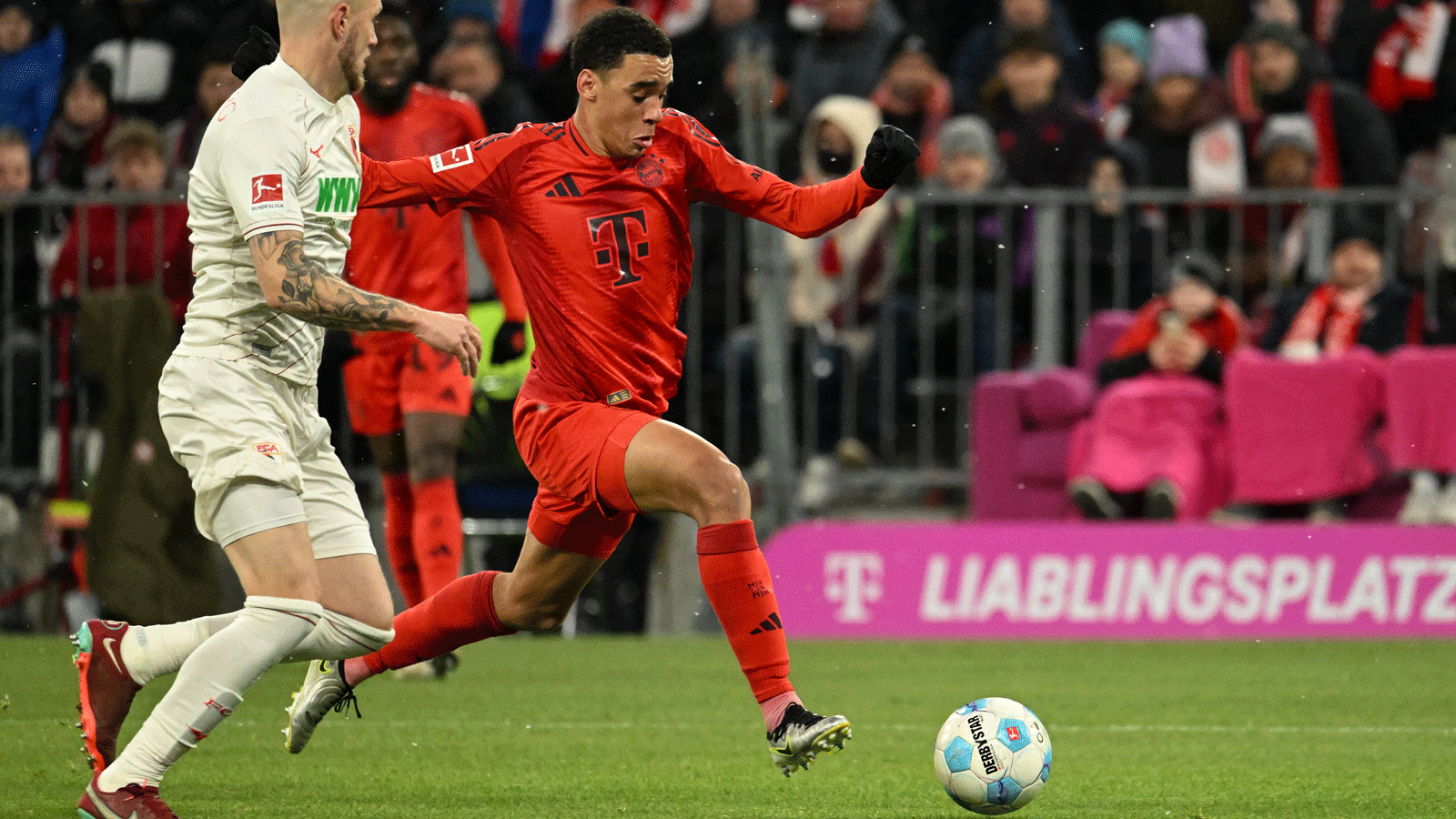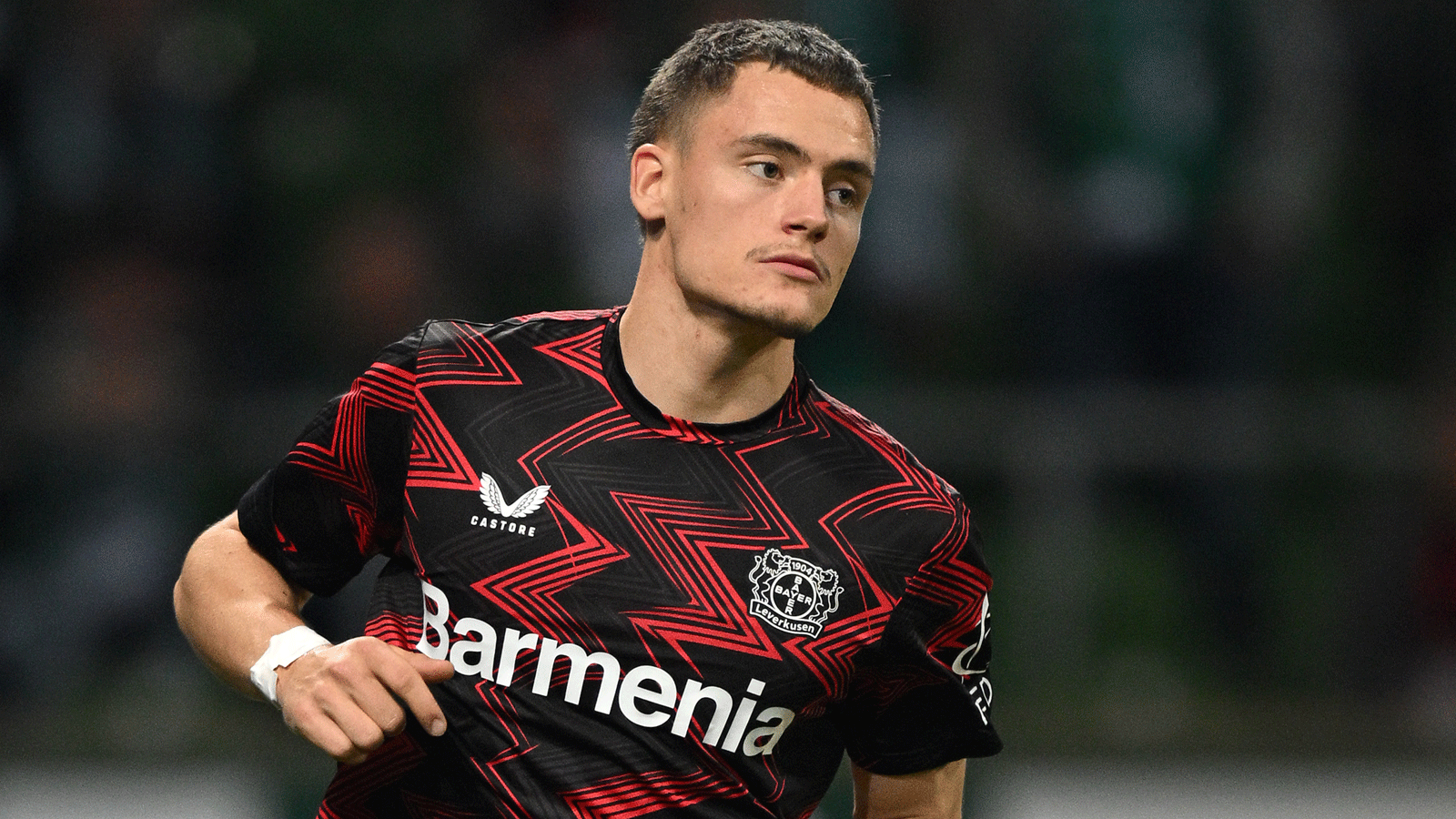Es schien die einzige Gewissheit für die kommende Saison im Welttennis zu sein, die fortschreitende Rivalität der beiden Spitzenspieler in der Weltrangliste, Andy Murray und Novak Djokovic. Und alle, die eine Fortsetzung des beherrschenden Duell des Jahres 2016 erwarteten, durften sich erst recht nach dem mitreißenden Endspiel des ATP-Turniers in Doha bestätigt fühlen - in der allerersten Woche der neuen Spielzeit. Djokovic siegte dort in der Wüste, Murray verlor: Der Rest der Karawane, so dachte man, würde in Melbourne die besten Beobachterplätze bei einem weiteren Finaldurchmarsch des Duos haben.
Und nun stehen plötzlich alle im Wanderzirkus vor der Erkenntnis, dass es auch im Männertennis noch so etwas wie Unberechenbarkeit und Überraschungsmomente gibt. Dass nicht immer die gewinnen, die zuletzt immer schon (fast) alles gewonnen haben. Dass ein Turnier verrückte Drehungen und Wendungen nehmen kann, die kein Fachmann oder Buchmacher auf der Rechnung hatte. Es war zwar durchaus wichtig für den Tennissport, dass es über viele Jahre eine ausgeprägte Hackordnung gab, mit einprägsamen, vertrauten Gesichtern, mit herausragenden Stars und Siegertypen. Aber es wurde einem zuletzt eben auch schon mal langweilig mit den ewig gleichen Gewinnern, auch mit einer monotonen Spielpraxis, also ermüdenden, stundenlangen Grundlinienduellen.
Murray und Djokovic, die Protagonisten dieser Entwicklung, sind nun herauskatapultiert aus dem Eröffnungsturnier. Es kann sein, dass es eine akute Schwächephase war, ein Augenblicksversagen. Aber manches deutet auch darauf hin, dass dieses anspruchsvolle Tennis, oft genug in Marathonkämpfen zwischen samt und sonders superfitten Profis ausgefochten, nicht mehr über längere Zeiträume auf allerhöchstem Niveau durchgespielt werden kann. Djokovic machte schon vor Melbourne einen ausgepumpten, erschöpften Eindruck, Murray wirkte mental blockiert gegen einen Gegner wie Mischa Zverev, der ihn plötzlich mit Serve-and-Volley-Tennis konfrontierte. Dieses Match, ganz nebenbei, war auch ein Fingerzeig für die Ausbildung von jungen Spielern, eine Aufforderung, Talente zu mehr Flexibilität und Kreativität zu erziehen.
Roger Federer ist in gewisser Weise ein Wanderer zwischen den Welten. Zwischen Tradition und Moderne. Er fühlt sich wohl als Mann der Abteilung Attacke, aber er hat auch das moderne, brutale Abnutzungstennis von der Grundlinie adaptiert. So hat er sich auch innerhalb der Turbulenzen dieses Wettbewerbs behauptet, er, der Comebacker, der auf der Jagd nach den ersehnten Grand-Slam-Pokalschätzen nun im Melbourne-Halbfinale steht. Und auf Stan Wawrinka trifft, bei dem man längst weiß, was er kann. Aber immer rätselt, wann er es zeigt. Wawrinka ist die Wundertüte auf zwei Beinen bei einem Turnier, das selbst als Wundertüte gilt. Was noch passieren wird in Melbourne? Niemand weiß es. Und das ist das Schöne.