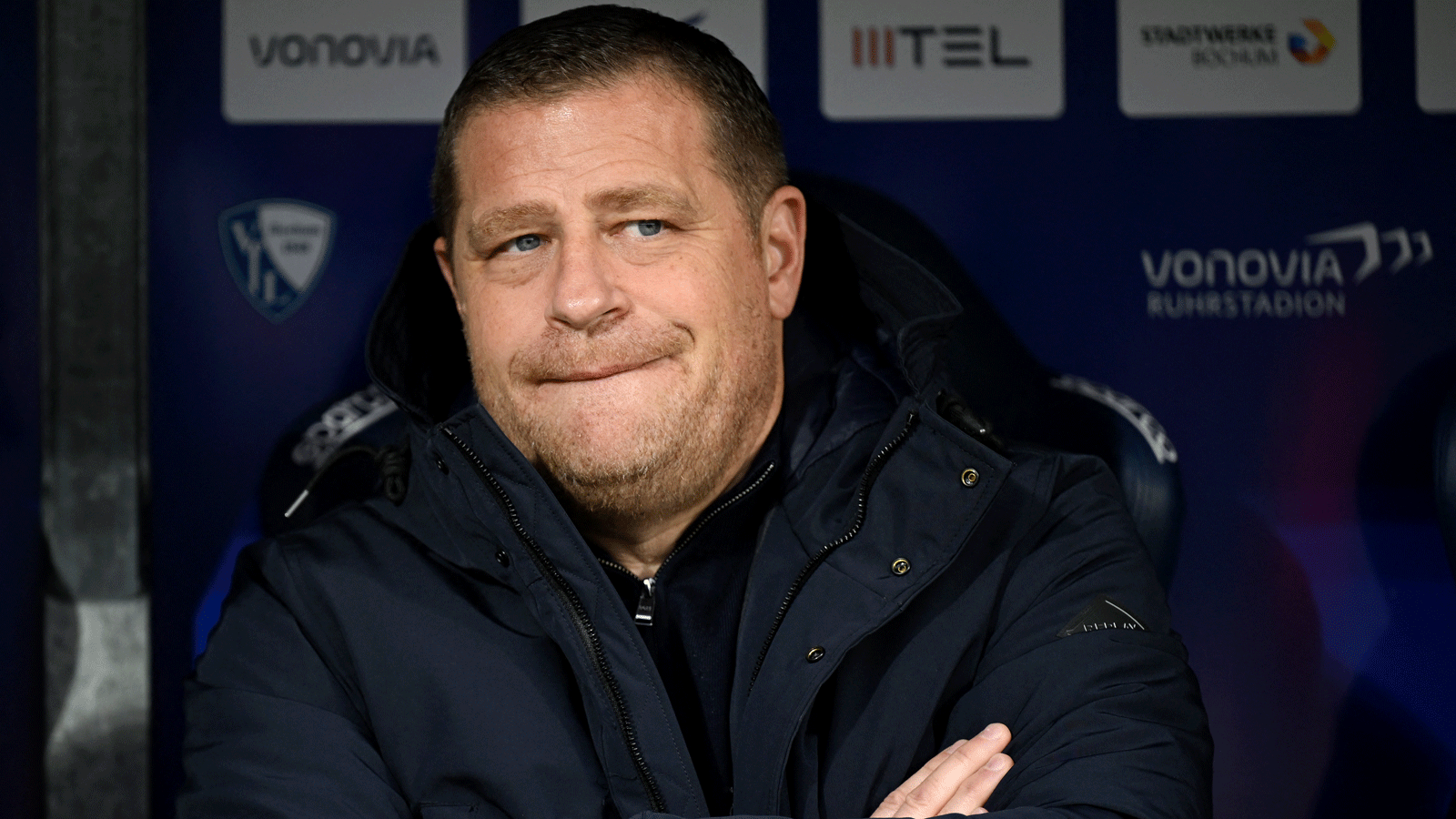Von Florian Goosmann aus Stuttgart
Kurz nachdem tennisnet.com vermeldete, dass Alexander Zverev bei seinem Heimturnier in Hamburg nicht auf der Meldeliste steht, saß Bruder Mischa in der Pressekonferenz in Stuttgart. Zverev hatte gerade sein Zweitrundenmatch gegen Yannick Hanfmann gewonnen, mit feinem Serve-and-Volley, als er zu seinen Hamburg-Plänen befragt wurde. Er habe nicht gemeldet, gab er zu Protokoll, um auf Nachfrage eine ausführliche und logische Begründung zu geben.
Zverev verwies einerseits auf sein schwaches Abschneiden auf Sand im Vorjahr und zu Beginn dieses Jahres (das Finale von Genf hatte er nach seiner Entscheidung gegen Hamburg erreicht), er machte aber auch die Denkweise der Spitzenprofis, zu denen er mittlerweile eben auch gehört, klar: Es habe für die meisten nach Wimbledon einfach keinen Sinn, für erneute drei Wochen auf Sand zu wechseln, wo kurz darauf oder teilweise zeitgleich die ersten Turniere im Rahmen der US-Hartplatzsaison anstünden. Würde er Hamburg spielen, so Zverev, müsse er die Woche darauf direkt in Washington auflaufen, "bei 35 Grad, auf Hartplatz und gegen Leute aus den Top 30". Ebenso in Montreal. "Das wäre eine harte Umstellung." So tritt Zverev bereits in der Hamburg-Woche in Atlanta - auf Hartplatz - an.
Was tun, ohne die Spitze?
Zverevs Argumente: Sie klangen, Hamburger Heimspiel, Sentimentalität und Dankbarkeit gegenüber Michael Stich mal außen vor, schlüssig; sie spiegeln die Denkweise wider, die so gut wie alle Profis in den vorderen Rängen verfolgen: Warum sollte ich mich nach Wimbledon noch mal für drei Wochen auf Sand umstellen (nicht nur spielerisch, sondern auch körperlich), wo es doch in den USA bereits auf Hartplatz losgeht - mit der Vorbereitung auf die US Open?
Die Frage ist, was tun? Für Traditionsturniere wie Hamburg, Gstaad, Kitzbühel und Co. wird es immer schwieriger, mit einem guten Programm aufzufahren; Federer, Nadal, Djokovic oder Murray denken nicht im Traum dran, nach Wimbledon noch mal auf Asche zu wechseln, ebenso immer seltener die Kollegen in den direkten Regionen dahinter. In Hamburg hat gerade mal ein Profi aus den Top 20 gemeldet - für ein 500er-Turnier ein bitteres Feld.
Der Traum: Eine wirkliche Rasensaison!
Um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, würde wohl nur ein Terminwechsel helfen - oder/und der Umstieg auf Rasen. In Stuttgart hat beides Wunder bewirkt: Der Weissenhof glänzt mittlerweile wieder, mit Stars und gefüllten Plätzen im Publikum.
Ein Ansatzpunkt: Wimbledon erst Mitte Juli zu starten - und mit Hamburg und Co. im Vorfeld (und auf Rasen) eine noch stärkere Vorbereitung zu ermöglichen auf das Turnier der Turniere.
Es wäre eine Win-Win-Situation, für alle Beteiligten: Wimbledon hätte einen längeren Vorlauf und könnte so seinen Martkwert nochmals steigern. Die kriselnden Sandplatzturniere hätten auf Rasen tieferen Sinn. Und die Spitzenprofis, die teilweise seit Jahren komplett (Djokovic) oder aufgrund der French-Open-Nachwirkungen teilweise (in diesem Jahr Nadal, früher auch ab und an Federer) auf eine Rasen-Vorbereitung verzichten, hätten mehr Zeit für Gras. Was ohnehin fehlt, trotz der Verlängerung der Zeit zwischen den French Open und Wimbledon von zwei auf drei Wochen, ist ein Turnier der 1000er-Kategorie. Und das auf dem Ursprungsuntergrund des Tennis!
Utopisch? Nun ja, zumindest kurzfristig. Zu viele Beteiligte müssten zügig an einem Strang ziehen: vorweg Wimbledon (und die ITF), ebenso wie die Sandplatzturniere selbst (sowie die ATP und die WTA). Sollte dies jedoch nicht bald geschehen, ist es gut möglich, dass einige Traditionsturniere auf lange Sicht von der Profi-Tennislandkarte verschwinden. Es wäre traurig - und ziemlich unnötig.