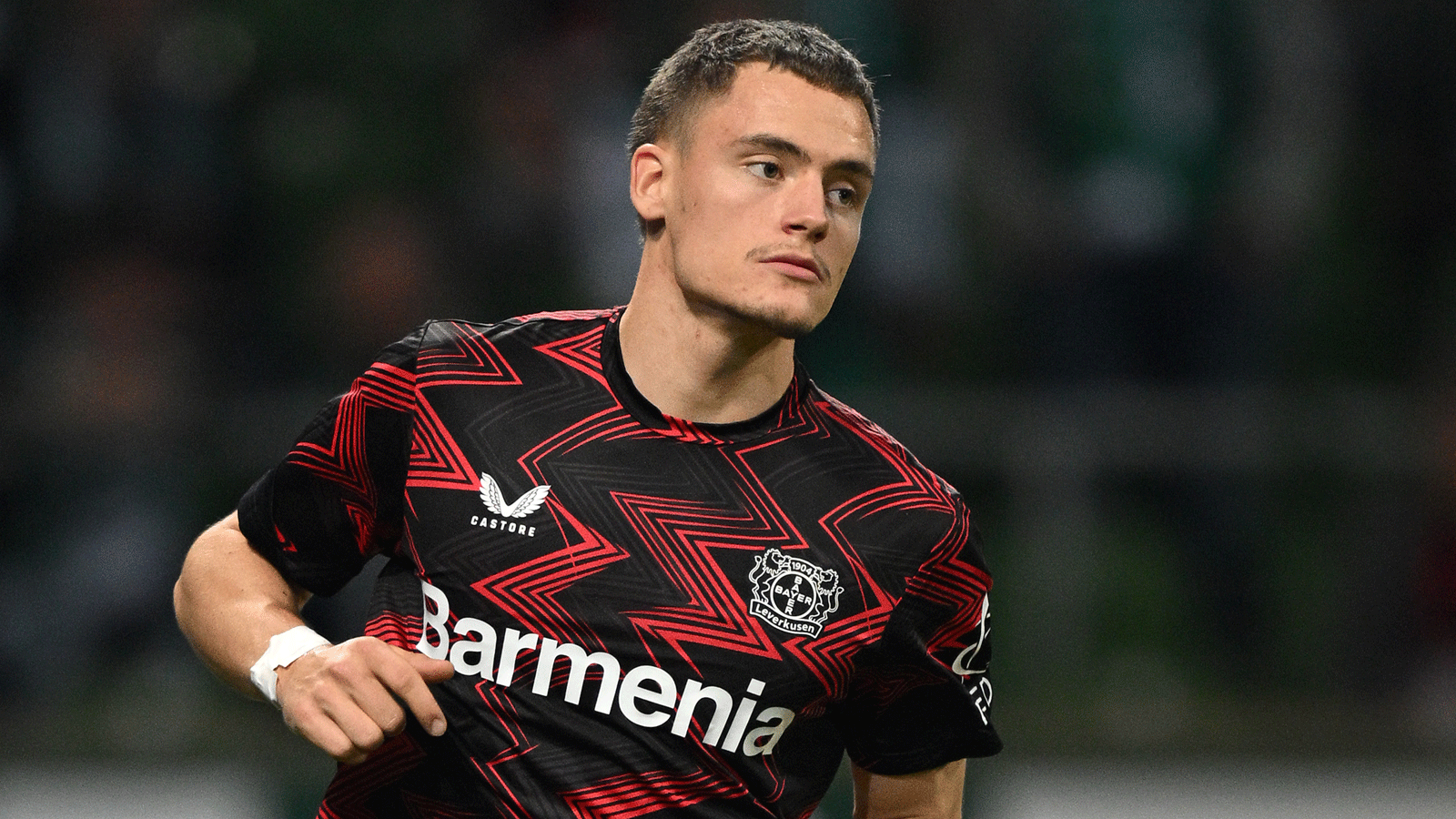Es ist ein Frühlingsabend in seidenweicher Luft, im mondänen Luftfahrtklub von Dubai. Boris Becker sitzt am Tisch, er ist in diesem Moment noch der Coach des damaligen Tennis-Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic. Becker hat ein Glas Rotwein vor sich, ab und zu steckt er sich einen Zigarillo an.
Es soll eigentlich um Djokovic gehen, um diesen Trainerjob, aber an diesem sehr entspannten Abend am Arabischen Golf geht es schnell um viel mehr. Es geht um sein ganzes Leben, um die Höhen und Tiefen, die er durchmessen hat. Es geht um die Brüche, die Verwandlungen, es geht auch um einen Becker, der immer auf der Flucht gewesen ist. Auf der Flucht, festgelegt zu werden. Vereinnahmt zu werden.
Becker war nie ein einziger Becker. Sondern ganz viele Beckers. Er war sehr früh und sehr entschlossen auch derjenige, der sich gegen die allzu innige öffentliche Umarmung auflehnte. Und der sich später über Kreuz legte mit Deutschland, mit allen, die meinten, ihm jeden Tag Ratschläge geben zu müssen.
Beckers Gesicht rötet sich an diesem Abend, als er auf dieses Thema zu sprechen kommt, eines seiner Lieblingsthemen: "Ich bin niemandem etwas schuldig. Ich lebe mein Leben, wie es mir gefällt", sagt er. Und natürlich fällt dann auch dieser Satz, den er in den letzten Jahren immer wieder gesagt hat: "In Deutschland glauben viele immer noch, dass ich der 17-jährige Bursche bin, der Wimbledon gewonnen hat."
Wimbledon als Ort der zweiten Geburt
Tatsächlich ist Becker ja der, der in diesem blutjungen Alter Wimbledon gewonnen hat. Aber er ist eben jetzt der Mann, der seinen 50. Geburtstag feiert, er hat vier Kinder von drei verschiedenen Müttern, er ist der Chef einer bunten Patchwork-Familie, er lebt längst in London, ganz bewusst weg von diesem schwierigen Deutschland, das er fasziniert hat als mitreißender Tennissolist. Und das ihn immer auch ein wenig argwöhnisch beäugt hat in den vielen Jahren nach der Profikarriere, in denen er nicht selten wie ein Hasardeur wirkte. "Ich bin dankbar, dass ich in London eine Heimat gefunden habe. Mit Menschen, die mich hier gut leben lassen", sagt Becker, "direkt neben einem Ort, der mir so viel bedeutet."
Was eine monströse Untertreibung ist: Denn Becker meint mit diesem Ort Wimbledon, das mythisch umrankte Tennisareal, dessen Centre Court er aus dem obersten Geschoss seines Hauses sehen kann. Wenn man so will, haben sich Becker und Wimbledon stets fest im gegenseitigen Blick. Was bedeutet ihm Wimbledon heute noch? "Es ist der Ort meiner zweiten Geburt", sagt Becker, "da fing ein anderes Leben an."
Fast alles, was in seinem Leben passierte, hat mit Wimbledon zu tun. Mit diesem 7. Juli 1985, an dem er den Matchball gegen den Südafrikaner Kevin Curren verwandelte und zum (bis heute) jüngsten Turniersieger in der Geschichte wurde. Von einer Sekunde zur anderen sei er "in ein anderes Universum geschleudert worden", sagt Becker in dieser Nacht in Dubai, "ich wollte natürlich immer ein großer Sieger sein. Aber was es bedeutet, Wimbledonsieger zu sein, wusste ich nicht."
Es begann ein Leben ohne Beispiel, ein Leben, das vor allem auch davon geprägt war, dass Becker gegen den Strom schwamm. Gegen die Erwartungen. Gegen die deutsche Wunschvorstellung, wie er als Idol sein sollte. Noch immer klingt diese Wut durch, wenn Becker nun, vor dem halben Hundert Lebensjahren, in einem Interview sagt: "Ich war nie euer Boris. Und ich bin nicht euer Boris." Und was er jetzt kühl anmahnt, nämlich der Herr Becker zu sein, das verlangte er Reportern auch schon früh ab, die ihn wie selbstverständlich im Kumpelton duzten.
"Tennis ist eine Religion. Und Becker ist ihr Gott"
Das Verrückte an Becker ist auch dies: In all den Aufgeregtheiten, in all dem Wirbel und allen Wirren seines Lebens ist er sich doch auch treu geblieben - als jemand, der sich nicht greifen lässt und sich auch nicht greifen lassen will. "Bei mir weiß man nie, was kommt", sagt Becker ganz trocken, "ich weiß es oft selbst nicht."
So war das ja auch in jenen Jahren, in denen er über die Kontinente und durch die Zeitzonen jettete. Und es war eben jene buchstäbliche Unfassbarkeit, die seine Magie ausmachte: Das Schwanken zwischen den Extremen, manchmal in einem Spiel, manchmal über ganze Jahre. Becker konnte Spiele drehen, die verloren schienen. Und Spiele verlieren, die er eigentlich schon gewonnen hatte.
Er fesselte die ganze Nation vorm Fernseher, er war ein Phänomen, in seiner Zeit der mitreissendste Tennisspieler, einer der bewegendsten Einzelsportler überhaupt. Alles, was er tat, wurde zur Staatsaffäre. Wurde von Literaten wie Martin Walser ("Tennis ist eine Religion. Und Becker ist ihr Gott") genau so wie von einem wie Bundespräsident Richard von Weizsäcker kommentiert. Hinter Beckers Dramen verschwanden sogar Auftritte der Fußball-Nationalmannschaft. Auch die Attitüde des Rebellen, die er zuweilen pflegte, war nationales Gesprächsthema, etwa, als er sich auf die Seite von Hausbesetzern in der Hamburger Hafenstraße schlug. Wie blickt er auf diese Zeit zurück? "Es war ein Leben, ständig am Limit. Ein verrücktes Leben. Ich hatte mit 20 schon mehr erlebt, als andere mit 100 Jahren", sagt Becker.
Boris Becker als verspäteter Vater
Es war allerdings auch so, dass Becker nicht leben konnte ohne die Anstrahlung des Scheinwerferlichts. Mit dem, was er selbst "Öffentlichkeit" nannte, verband ihn immer eine Hassliebe. Er genoss seine Bekanntheit, seine Popularität. Und er verfluchte sie im nächsten Moment. Und daran hat sich auch nicht viel geändert in all den Jahren bis zu seinem Fünfzigsten jetzt - an Becker und dem Thema Becker war nie ein Mangel.
Auch nicht, weil sich ein zweiter einschneidender Moment in seinem Leben - wiederum im Umfeld von Wimbledon - abspielte, bei seinem allerletzten Tennisturnier, am Abend nach seinem finalen Match gegen den Australier Pat Rafter. Becker war in jenem Juli 1999 schon Familienvater, er hatte mit seiner Frau Barbara einen Sohn, Noah, und das Ehepaar war in guter Erwartung des zweiten Kindes.
Und dann dies: Nachdem Becker mit deutschen Journalisten beim gemeinsamen Plausch über das letzte Wimbledon und das neue Leben schon ordentlich gezecht hat - am Ende stehen Dutzende Becks-Flaschen auf dem Tisch des Deutschen Hauses in Wimbledon -, lässt er sich in die Londoner City chauffieren. Später an diesem Abend zeugt er mit der zufälligen oder nicht so zufälligen Bekanntschaft Angela Ermakowa eine Tochter. Drei Monate später flattert einer Rechtsanwaltskanzlei Beckers ein Faxschreiben auf den Tisch, in dem die Schwangerschaft von Frau Ermakowa bekanntgegeben wird. Und als Vater Boris Becker identifiziert wird.